Katharina Wagner brachte es jüngst in einem Interview auf den Punkt: „Wolfgang Wagner war ein Mensch, über den zahllose Geschichten kursierten – wahre und erfundene, humorvolle und zornige“. Einige dieser Geschichten kann Hobbyhistoriker Stephan Müller beitragen. Diese sind, wie er verspricht, nicht erfunden.
Mit der Stadtpolizei in die Eule
Beginnen wir mit einer Lieblingsgeschichte von Wolfgang Wagner, die es sogar in seine Biografie „Lebensakte“ geschafft hat. Wieder einmal hatten sich die beiden berühmten Dirigenten Hans Knappertsbusch und Joseph Keilberth, den der „Kna“, um ihn zu ärgern immer nur „Keilberg“ nannte, heillos gestritten. So kam Keilberth in das Büro von Wolfgang Wagner, um sich den Frust von der Seele zu reden und wohl auch zu trinken.

Dirigent Keilberth, Foto: Bernd Meyer Stiftung
In seiner Lebensakte erzählt Wolfgang Wagner: „Einmal trank der Dirigent Joseph Keilberth in meinem Büro sieben tröstende Bocksbeutel, also insgesamt fast fünf Liter Wein. Ich erschrak furchtbar, als er mir mitteilte, dass er noch zu einem abschließenden Nachttrunk noch in das Künstlerlokal „Eule“ fahren wollte.“
Nachdem es Wolfgang Wagner nicht gelang, dem Dirigenten die Autoschlüssel abzunehmen, rief er die Stadtpolizei an. Die Beamten schauten sich die Sachlage an und entschlossen sich zu einer interessanten Aktion: Statt Keilberth den Autoschlüssel per Amtsgewalt zu konfiszieren, ließen sie ihn selbst ans Steuer, nahmen den VW-Käfer mit ihren zwei Dienstwagen in die Mitte, um ihn mit Blaulicht sicher zum Markt zu geleiten.
Wolfgang Wagner: „Wehmütig denken wir heute an solch städtische Serviceleistungen, in der die Promille nicht den strafenden Arm des Gesetzes beschworen, sondern dessen verständig-bedachtsam helfende Hand.“
Franz Josef Strauß will die Festspiel-Zuschüsse streichen
„Eines versprechen Sie mir: Wenn Sie in der Bundesrepublik bleiben wollen, dann tun Sie das nicht während Ihres Engagements bei den Bayreuther Festspielen, sondern später!“ sagte Wolfgang Wagner zu Götz Friedrich, den er direkt aus der DDR für eine neue „Tannhäuser“-Inszenierung verpflichtet hat. Nachdem sich der Italiener Giorgio Strehler nicht entscheiden konnte („Er war etwas problematisch in seinen Zu- und Absagen“) engagierte er Götz Friedrich, der noch nie eine Wagner-Oper inszeniert hatte und von dem er auch nie zuvor eine Inszenierung gesehen hatte.
Und Götz Friedrich sorgte auch erst einmal für Schlagzeilen: Seine Inszenierung sorgte 1972 für einen handfesten Skandal, der durch den Kalten Krieg noch verstärkt wurde: CSU-Chef Franz Josef Strauß empörte sich damals, dass der Minnesänger Tannhäuser nicht als Held, sondern als Revolutionär dargestellt wurde. Wegen des Schlussbildes mit dem „Betriebskampf-Gruppenchor der volkseigenen Betriebe Rote Lokomotive in Leipzig“ (Strauß) kündigte er die Streichung der Zuschüsse durch den Freistaat Bayern an und verließ demonstrativ den Staatsempfang im Neuen Schloss, als Götz Friedrich dort eintraf.
Übrigens hielt Götz Friedrich sein Versprechen an Wolfgang Wagner und kehrte nach den Bayreuther Festspielen nach Ostdeutschland zurück. Geflohen ist er erst ein halbes Jahr später, als er im November 1972 von einem Gastspiel in Stockholm nicht mehr in die DDR zurückkehrte und im Westen blieb.
Keine Angst, ich singe hier nicht
„Ist jemand hier, der Recht mir weiß, der tret‘ als Zeug‘ in diesen Kreis!“ Kurz nach dem Aufruf von Hans Sachs tritt werkgetreu Walther von Stolzing hervor und begrüßt Sachs, Meister und Volk mit ritterlicher Freundlichkeit. Alles weilt einen Augenblick schweigend in seiner Betrachtung.
Auch bei der „Meistersinger“-Aufführung am 28. August 1997 weilten erst einmal alle „schweigend in seiner Betrachtung, bekamen dann aber große Augen, als nicht Stolzing sondern Wolfgang Wagner auf die Bühne kam und dem überraschten Dirigenten Daniel Barenboim andeutete, dass er mal abbrechen soll.
Den mucksmäuschenstillen Zuschauern sagte er „Keine Angst ich singe hier nicht“ und teilte dem Publikum mit, dass nun Robert Dean Smith für den indisponierten Peter Seiffert als Stolzing weitersingen werde. Smith tat es und das Publikum tobte nach der Leistung des Debütanten vor Begeisterung. Wolfgang Wagner blieb übrigens gleich auf der Bühne und nahm – „im Smoking“ – zwischen dem Festspielchor Platz…

(links) Robert Dean Smith bei einer Signierstunde. Foto: Stephan Müller
Hans Walter Wild, der Parterre-Akrobat
Durch den Kulturreferenten der Stadt Bayreuth, Max Kuttenfelder, erhielt der junge Rechtsrat Hans-Walter Wild, lange bevor er Oberbürgermeister wurde, zwei Generalproben-Karten für eine „Tannhäuser-Aufführung“. Mit hochgespannter Erwartung pilgerte er mit seiner Frau Gerda zum Festspielhaus, allerdings vorgewarnt durch den Hinweis, dass die Generalproben nicht selten unterbrochen würden, wenn sich dies aus betrieblicher oder künstlerischer Notwendigkeit als erforderlich erweist.

Hans Walter Wild und Wolfgang Wagner. Foto: Stephan Müller
Und so geschah es denn auch. Das Ehepaar Wild hatte Plätze in den hinteren Reihen und verfolgte mit großem Interesse, wie sich Wieland und Wolfgang Wagner bemühten, auch noch die letzten Zuschauer hinaus zu bugsieren. Wild in seinem Buch „Denk ich an damals…“: „Wie hielten uns lässig bedeckt und hofften, wir würden übersehen oder die Räumung sei vielleicht nicht so ernst gemeint.“
Wie ein Bannstrahl traf sie der Zuruf Wolfgang Wagners: „Na, was ist denn mit Euch, ihr Parterre-Akrobaten!“ Weder er noch Hans-Walter Wild ahnten, dass der eine Parterre-Akrobat später, als er schon lange Oberbürgermeister war, einmal sein Trauzeuge sein würde. Wenige Tage vor der Festspielpremiere 1976 war Hans-Walter Wild erstmals in seinem Leben bei der Verehelichung von Wolfgang und Gudrun Trauzeuge. „Und ein nicht einmal ganz unbedeutender…“
Ich muss mich entschuldigen
Die sogenannte Hauptprobe, also die letzten Probe einer Neuinszenierung vor der Generalprobe, ist sehr oft „gesperrt“. In den Zuschauerraum dürfen wirklich nur Mitwirkende, die tatsächlich unmittelbar beschäftigt sind. „Du bist Ersatz eines Statisten. Setz Dich rein“, sagte der „Tannhäuser“-Regisseur Philippe Arlaud in seinem französischen Akzent zu einem Statisten! Er tat es und traf auf Wolfgang Wagner, der ihn hochkant hinauswarf.
Ungerecht behandelt fühlte er sich schon, einen roten Kopf hatte er auch, fasste aber den Entschluss besser nichts zu sagen und mit kurzen schnellen Schritten das Parkett zu verlassen. Umso erstaunter war er, dass ihn der Festspielleiter am nächsten Tag vor einer Probebühne am Arm nahm und sagte: „Ich muss mich entschuldigen“, ich wusste nicht, dass sie rein durften. Warum hamm’s denn nix g’sagt?“ – das war Wolfgang Wagner!
Banale Geschmacklosigkeit

(v.l.) Jo Schumacher und Wolfgang Wagner: Alles wieder gut. Wagner ist nicht aus dem Fremdenverkehrsverein ausgetreten. Foto: Stephan Müller

Foto: Bayreuth aktuell
Auch der langjährige Fremdenverkehrsdirektor Jo Schumacher hatte ein besonderes Erlebnis mit dem Festspielleiter. „Das ist toll. Das ist witzig.
Das Titelblatt zeigen Sie mal gleich Wolfgang Wagner“, sagte Oberbürgermeister Hans Walter Wild, der von der Fotomontage für die Monatsschrift „Bayreuth aktuell“ begeistert war und Schumacher tat, wie es ihm geheißen wurde.
Die Antwort von Wolfgang Wagner vom 4. Juli 1985, mit der Schumacher allerdings nicht gerechnet hatte, kam schriftlich und wurde „durch Boten“ übermittelt.
Sehr geehrter Herr Schumacher,
Sie haben mir das Plakat mit dem Breker-Kopf, Lippenstiftkussmund (bereits in Bonn sattsam verwendet), Regenschirm und merkwürdiger junge Dame zugeschickt .
Ich bedauere außerordentlich, dass Bayreuth dem allgemeinen Trend banaler Geschmacklosigkeiten nunmehr auch folgt. Nachdem Apotheken und andere Einrichtungen sich Namen der Werke Richard Wagners aus opportunistischer Werbewirksamkeit zugelegt haben, wundert mich leider langsam nichts mehr – ich darf hiermit meine Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverein bayreuth aufkündigen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Wagner
(Kopie an Herrn Oberbürgermeister Hans Walter Wild)
Nachtzutragen ist, dass Oberbürgermeister Hans Walter Wild, immerhin Wolfgang Wagners Trauzeuge, letztendlich besänftigend auf ihn eingeredet und Wagners Austritt aus den Fremdenverkehrsverein verhindert hat.
Wolfang Wagner als Geschichtenerzähler
Solisten, Chorsänger, Techniker und Statisten haben sich von der Bühne aus immer wieder gewundert, aus welcher Ecke des Festspielhauses Wolfgang Wagner aufgetaucht ist. „Plötzlich steht er neben Dir. Entweder es gibt ihn öfters oder uns sind noch nicht alle Geheimgänge bekannt“, war ein gängiger Kalauer im Festspielhaus. Die Mitwirkenden liebten „ihren Chef“ und seine Geschichten, die er immer dann zum Besten gab, wenn sich jemand in einer Pause zu fragen traute. Von der Autorität und fränkischen Sturköpfigkeit, die er gegenüber den Medien an den Tag legte, war dann nichts zu spüren. Und Geschichten hatte er, der schließlich noch zahlreiche große Menschen aus dem 19. Jahrhundert kennengelernt hatte, immer parat. Und dann hing ihm eine ganze Meute an den Lippen.
Schließlich wuchs der „Chef“ mit vielen Menschen auf, die Richard Wagner noch selbst gekannt hatten! Es war schon atemberaubend, wenn man im 21. Jahrhundert einen Mann befragt, der immerhin bis zu seinem elften Lebensjahr mit Cosima Wagner im Haus gelebt hatte – einer Frau, die am 1837 am selben Tag wie die Kaiserin Sissi von Österreich geboren worden war, und hautnah die Gründung der Festspiele miterlebt hatte.
Erzählt hat er immer höchst unkonventionell, von Cosima zum Beispiel: „Sie konnte ja am Schluss nicht mehr richtig“, sagte er. „Sie saß den ganzen Tag in ihrem Rollstuhl, bis wir sie nach dem Fünf-Uhr-Tee, wenn sich die ganze Familie versammelte, in ihr Bett hoben. Vorher haben sie Wieland und ich immer noch an den Füßen gekitzelt, weil wir wissen wollten, ob sie noch lebt.“
„So! Jetzt sterbe ich wann ich will!“
Beim Streit um seine Nachfolge setzte er sich, wie es Museumsleiter Dr. Sven Friedrich jüngst erzählte, über das Votum der Richard-Wagner-Stiftung umstandslos mit Hinweis auf seinen Lebenszeitvertrag als Festspielleiter hinweg und blieb einfach im Amt.
Wenige, so der Museumsleiter, aber wissen, wie er seine Entscheidung damals kommentierte, nämlich mit einem typischen, trotzigen „So! Jetzt sterbe ich wann ich will!“ Er tat es 21. März 2010 im Alter von 90 Jahren.
Text: Stephan Müller
Stephan Müller (53) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.
Lesen Sie auch:









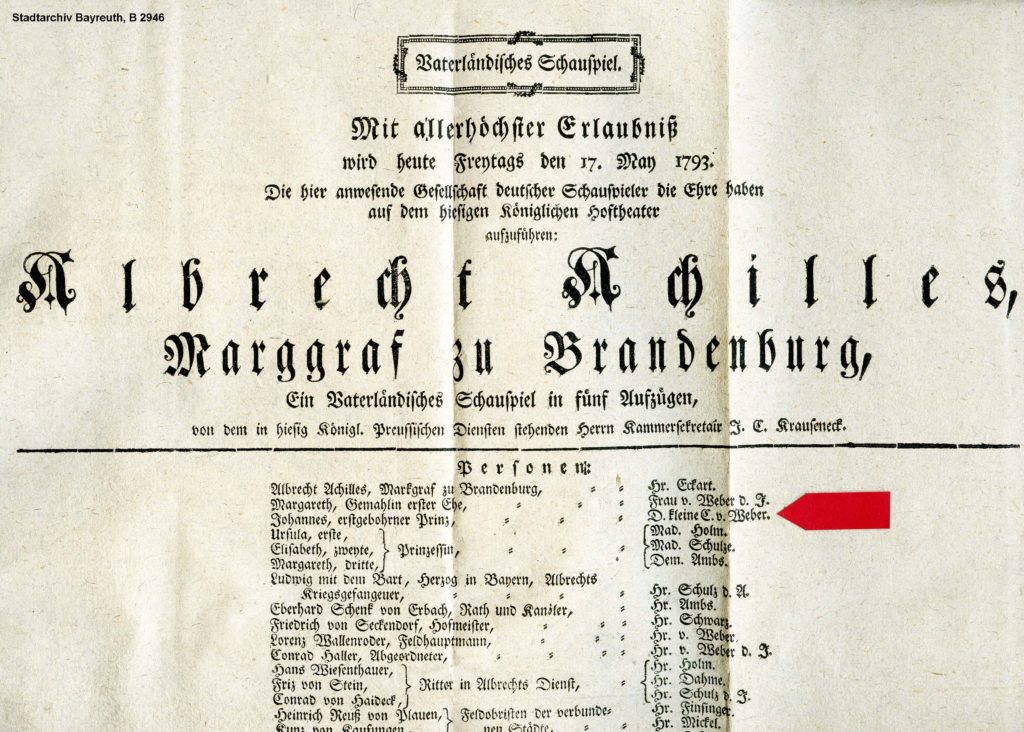






























 Wie fast alle Markgrafen aus dem Haus Hohenzollern war auch Markgraf Friedrich ein passionierter Jäger. Er hatte sich gleich zu Beginn seiner Regierung in Bayreuth Pferde und Hunde aus England kommen lassen, um Parforcejagden mit Hunden abhalten zu können. Eine der ersten Gelegenheiten, die sich dafür bot, war der Besuch des unbeliebten Schwagers. Schließlich nahm die Jagd als zentrales Ereignis höfischer Repräsentation eine herausragende Stellung ein.
Wie fast alle Markgrafen aus dem Haus Hohenzollern war auch Markgraf Friedrich ein passionierter Jäger. Er hatte sich gleich zu Beginn seiner Regierung in Bayreuth Pferde und Hunde aus England kommen lassen, um Parforcejagden mit Hunden abhalten zu können. Eine der ersten Gelegenheiten, die sich dafür bot, war der Besuch des unbeliebten Schwagers. Schließlich nahm die Jagd als zentrales Ereignis höfischer Repräsentation eine herausragende Stellung ein.
